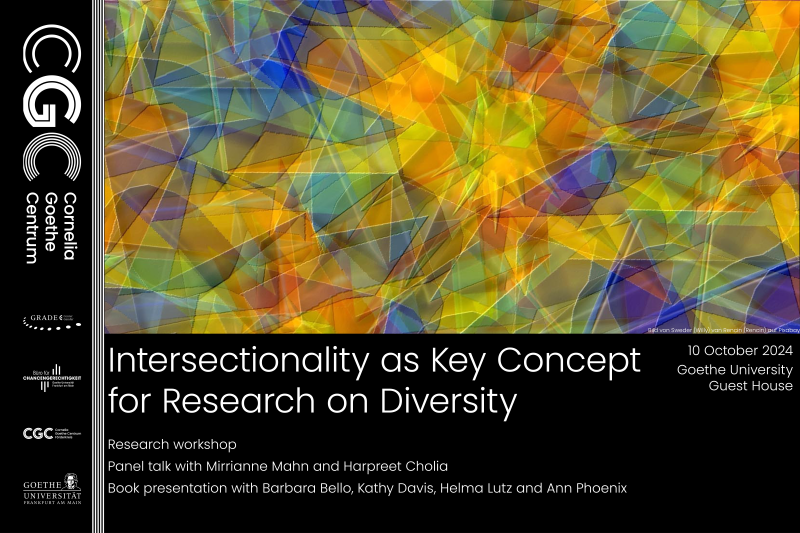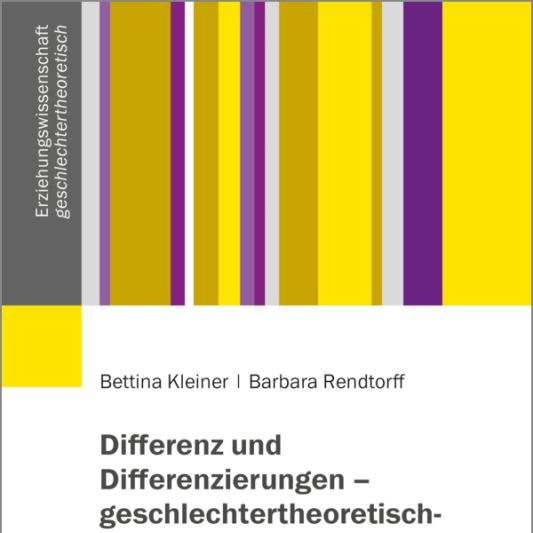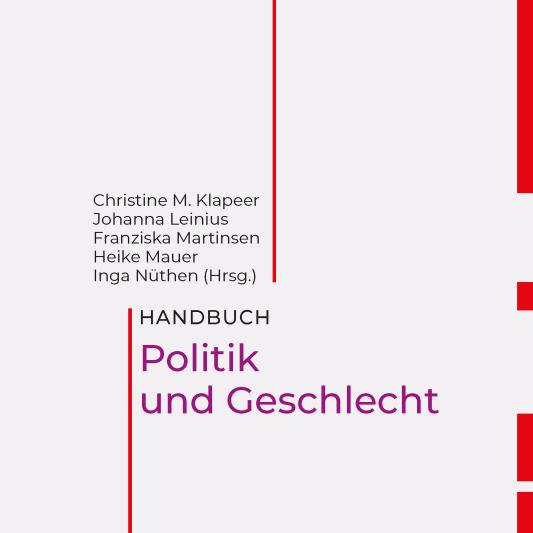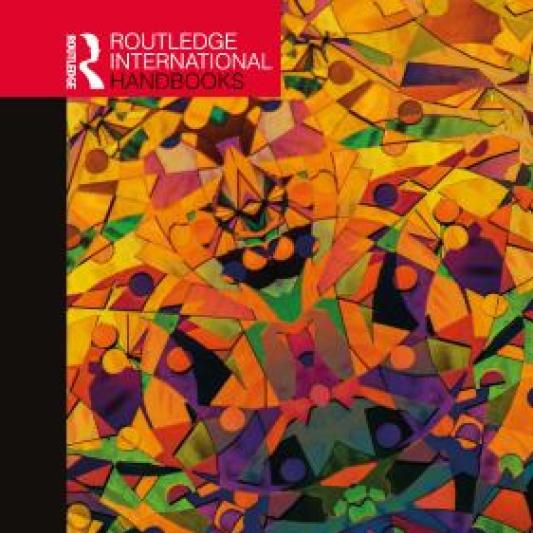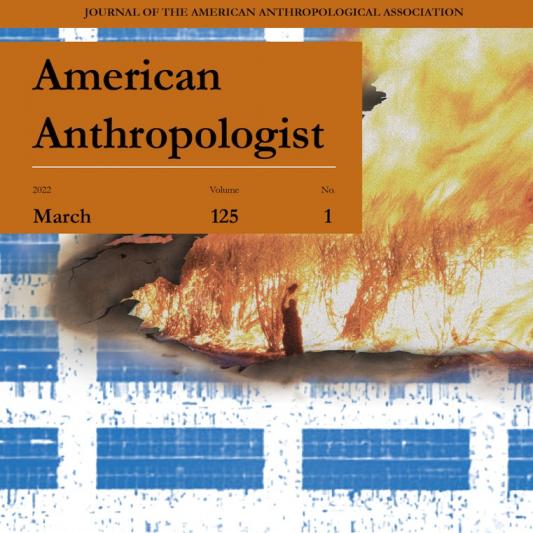Das Veranstaltungsverzeichnis des Zertifikatsprogramms Gender Studies ist (fast) fertig. Wir haben die vorläufige Version nun hochgeladen, damit Sie Ihre Veranstaltungen aussuchen und belegen können.
Kommende Veranstaltungen
Aus dem CGC
Neue Publikationen
Bettina
Kleiner
Barbara
Rendtorff
Christine M.
Klapeer
Johanna
Leinius
Franziska
Martinsen
Heike
Mauer
Inga
Nüthen